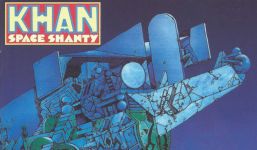JJ Grey ist eines der wertvollsten Geschenke, das die Musikwelt in den zurückliegenden 25 Jahren hervorgebracht hat. Bereits auf Platte war sein zwingender Groove-Cocktail aus heiß brodelndem Soul, hypnotischem Funk, Gospel und sumpfig-bluesigem Southern-Rock ein stets beeindruckendes Erlebnis — seine Konzerte eine geradezu spirituelle Erfahrung, die man in Europa viel zu selten machen durfte.
2012 spielte er eine Tournee in deutschen Kleinst-Clubs, auf deren Bühnen er seine mit Bläsern und Hammondorgel personell üppig besetzte Band Mofro übereinanderstapeln musste; zwei Jahre darauf eröffnete er in größerem Stil die Konzerte der Tedeschi Trucks Band. Sein letztes Studio-Album erschien mit Ol’ Glory vor geschlagenen neun Jahren — das künstlerische Leben des Soulmannes aus Florida hatte sich längst in seine Heimat verlagert. Aber auch dort war immer weniger von ihm zu hören.
Nein, lacht Grey, im Knast sei er nicht gewesen, was sein Abtauchen zumindest erklären würde. Auch nicht in der Reha. Der Grund, warum es fast neun Jahre bis zu einem neuen Album gedauert habe, sei viel banaler, erzählt er. »Eigentlich habe ich recht zügig nach dem Erscheinen von Ol’ Glory mit der Platte begonnen, aber dann sind mir einfach immer wieder die unterschiedlichsten Dinge dazwischen gekommen. Ich dachte mir, die Zeit würde schon noch kommen. Tat sie ja auch. Erschreckenderweise aber fast ein Jahrzehnt später.«
Für eine Platte brauche er eben Zeit. »Ich will nicht das Gefühl haben, dass ich nächsten Freitag fertig sein muss, obwohl mir noch ein paar Textzeilen fehlen.« Mehr als früher, als er noch keine Familie hatte, von der er sich nicht gerne trennen mag — auch deshalb gehe er nicht mehr gerne auf ewig lange Tourneen. »Das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, du bist mehr daheim und kannst kostbare Zeit mit den Kindern und der Familie teilen. Der Nachteil ist, dass die nächste Tour eben doch immer im Hinterkopf ist.«
Otis Redding. Die frühen Creedence Clearwater Revival (Bayou Country). Wilson Pickett. Die Vergleiche kann Grey bald nicht mehr hören, auch wenn sie sich nach wie vor aufdrängen in seiner Musik, die als sumpfiger Soul-Funk-Hybride analoge Wärme abstrahlt und so bodenständig ist wie JJ Grey selbst. Dass auf Olustee trotz aller Vertrautheit manches einen Tacken anders tönt, hat damit zu tun, dass der Sänger seine imposante Stimme erst wiederfinden musste, nachdem sie durch den fortlaufenden Tour-Betrieb der Vergangenheit extremen Belastungen ausgesetzt war.
»Wenn du dir richtig etwas einfangen willst, dann musst du entweder in einer Grundschule vorbeischauen oder mit dem Bus auf Tour sein«, erzählt der Musiker mit warmherzigem Südstaaten-Slang und schmunzelt. »Der Bus ist wie eine Petrischale voller Keime. Bei mir war es so, dass ich hartnäckigen Husten bekam und heiser wurde und beides gar nicht mehr loswurde. Trotzdem habe ich 100 bis 150 Shows gespielt. Das ging auf die Stimmbänder. Ich musste immer mehr Kraft und Luft aufwenden beim Singen. Mein Stimmumfang wurde kleiner. Und irgendwann habe ich Blut gehustet. Und dann ging überhaupt nichts mehr.«
Eine ärztliche Untersuchung ergab, dass sich seine Stimmlippen nicht mehr richtig schlossen und er zudem unmittelbar vor einer Lungenentzündung stand. »Ich musste neu lernen, meinen Atem zu kontrollieren und gezielt einzusetzen. Und ab diesem Punkt kam die Stimme dann langsam zurück. Und ich gewann tiefe Töne dazu. Das Wichtigste dabei war, meine Ängste loszulassen. Denn die Rückkehr meiner Stimme geschah praktisch live auf der Bühne vor Publikum, Abend für Abend.«
Wie das genau passiert ist, kann JJ Grey nicht wirklich erklären. Tatsache ist: Heute klingt er entspannter, emotionaler und auch beweglicher am Mikrofon. »Ich werde jetzt häufig drauf angesprochen. Für mich selbst ist es einfach zur Selbstverständlichkeit geworden, nun etwas anders zu klingen. Auf jeden Fall fühlt es sich so einfach komfortabler an. Wobei es ja nur ganz subtile Veränderungen sind.«
Seine neuen Songs, wie der heiße Retro-Funk ›Rooster‹ oder die episch aufgebaute Ballade ›The Sea‹, zeigen ihn als Sänger, der sich seine bekannte Coolness bewahrt und zugleich an Tiefe und stimmlicher Fülle hinzugewonnen hat. Zudem atmet Olustee einen warmen und lebendigen Sound mit eindeutig analoger Handschrift, die im traumhaft schönen ›Seminole Wind‹ Greys typischen Swamp-Soul-Rock so klar mit den originären Lynyrd Skynyrd verbindet wie noch nie.
»Ich bin ja ein Gear-Nerd und habe bisher alles immer analog auf altes Tonband aufgenommen. Tonband ist teuer, es zwingt dich im Studio dazu, bei der Sache zu bleiben und dich nicht zu sehr in Details zu verlieren«, bekennt Grey. »Durch Seasick Steve bin ich auf diese Analog-Konverter gekommen, die im letzten Arbeitsgang die Musik auf eine Festplatte spielen statt aufs Band. Aufnahmen auf Band haben eine Tiefe und Struktur, die digitale Aufnahmen für mein Ohr nicht bieten. Digitale Aufnahmen klingen flach. Meine Demos hier zu Hause klingen flach. Aber mit den Konvertern merkt man den Unterschied praktisch nicht mehr wirklich. Nur das Bandrauschen fehlt. Und ansonsten habe ich ja auch mein altes Equipment eingesetzt.«
Treu geblieben ist er zudem der inhaltlichen Ebene, die seine Musik seit jeher begleitet — und die eng mit seiner Liebe zur Natur und der Gegend rund um Jacksonville verbunden ist, in der Grey aufwuchs. Mit der Schlacht von Olustee in Florida im amerikanischen Bürgerkrieg hat Olustee erwartungsgemäß nichts zu tun.
»Es geht nicht um die Geschichte dieser Stadt, sondern um die zivile Ortschaft«, erklärt der Sänger den energischen Song. »Mein Großvater ist in der Nähe von Olustee aufgewachsen. Er hat mir mal von einem Waldbrand erzählt, den er dort erlebt hat. Ich habe auch selbst schon solche Brände erlebt und musste deswegen einmal sogar um mein Leben laufen. Darum geht es in dem Song. Wie schnell man manchmal schauen muss, dass man in Sicherheit kommt. Die Songs auf Olustee erzählen viele persönliche Geschichten. ›Top Of The World‹ zum Beispiel habe ich über die zahllosen Sandbänke im Fluss hinter meinem Haus geschrieben. Im Sommer fahren da alle mit ihren Booten hin und feiern. Überall läuft Musik, die Leute werfen den Grill an, es ist eine großartige Stimmung. Ich habe schon so viele Songs über wirklich schwere Zeiten geschrieben — jetzt sollte es auch mal einen über die guten geben. Ein Lied über Partys auf den Sandbänken!«
Auch das geliebte Meer weiß er vor der Haustür und beschreibt in ›The Sea‹ das Gefühl seiner Verbundenheit mit dem feuchten Element. »Manchmal scheint der Übergang vom Meer in den Himmel am Horizont nicht zu existieren, wenn man darauf schaut«, so der Musiker. »Das passiert, wenn das Meer ganz ruhig ist. Um dieses Gefühl ging es mir beim Schreiben. Ich bin damit aufgewachsen.«
Während Grey sich als Texter und Troubadour weitgehend treu geblieben ist, hat er sich als Musiker und Komponist auf Olustee deutlich weiterentwickelt. »Gute Songs schreiben sich ja eigentlich von allein, als Musiker bin ich nur das Gefäß für sie. Aber ich wollte dem Bild sozusagen mehr Farben hinzufügen und mehr Blicke auf die Landschaft werfen. Ich wollte Momente der Schönheit schaffen, die nicht so sehr dem Zufall geschuldet waren wie in der Vergangenheit.«
Die Umsetzung dieses Wunsches hat Grey viel Neues erfahren lassen: »Bei vier Songs haben wir das Sinfonieorchester Budapest eingesetzt. Streicher und Bläser habe ich immer schon gern verwendet, aber dieses Mal sind wir damit weiter gegangen. Die Aufnahmen haben wir übers Internet in Echtzeit mit den Musikern in Europa gemacht. Es war magisch! Ich liebe Orchester und viele klassische Stücke, vieles davon rührt mich zu Tränen.«
Dieser Text stammt aus ►ROCKS Nr. 99 (02/2024).