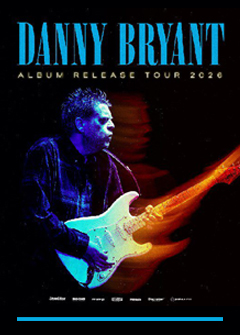Man kann nun wirklich nicht behaupten, dass sich Airbourne auf ihren Lorbeeren ausruhen und immer dieselbe Power-Riff-Rock-Platte abfeuern würden. Denn dafür, dass ihnen Kritiker so gerne vorhalten, zu kaum mehr in der Lage zu sein als dem immer gleichen Gebläse im volle Pulle-Modus, haben die Australier ihrem Sound schon so manche Facette abgerungen.
Das Fundament ihres Radaus ist freilich noch dasselbe wie auf dem Erstling Runnin’ Wild, auf dem Airbourne vor zwölf Jahren im Grunde nichts anderes taten, als den von AC/DC, Rose Tattoo und frühen Rhino Bucket vorgelebten Hardrock mit jugendlichem Drang und ganz bedenklich hohen Dosen Adrenalin aufzupumpen.
Dass sich ihr Vollgas-Konzept kaum bis in alle Ewigkeit ausreizen lassen würde, war die wohl wertvollste Erkenntnis aus dem erfolgreichen, aber doch reichlich affektierten Abklatsch No Guts. No Glory (2010), dem die Band zwei recht besonnene Platten entgegensetzte, deren aufwändige Studioproduktionen das perfekte Bett für zunehmend durchdachte Songs mit dynamischen Kniffen und kräftig ausgewalzten Stadion-Refrains abgaben: Erst mit Black Dog Barking (2013) und Breakin’ Outta Hell (2016) wurde aus einem unterhaltsamen Spleen ein überlebensfähiger eigener Sound.
Es dürfte kaum jemanden geben, der sich allen Ernstes darüber beschwert hätte, wenn die Band der O’Keeffe-Brüder Joel und Ryan genau so weitergemacht hätte. Stattdessen haben Airbourne das mutigste Album ihrer Karriere eingespielt, auf dem sie zum Herzen und der Seele ihrer fest im Boden Australiens verwurzelten Musik vordringen — und dabei vollkommen uneitel in Kauf nehmen, weniger von der Größe und der umwalzenden Breitwand-Power auszustrahlen, die ihnen moderne Erfolgsproduzenten wie Bob Marlette zuvor so wirkungsvoll eintrichterten. Was ihren Sound am einen Ende etwas kleiner macht und von den Arenen zurück in die stinkigen Clubs versetzt, räumt am anderen mit sämtlichen Restvorbehalten auf, die man gegen diese Band noch haben könnte.
Bei allem Biss und Funkenflug zeichnet sich ihre fünfte Platte nämlich durch Qualitäten aus, für die Airbourne auf Konserve bislang weniger bekannt waren: Belebende Dynamik, organische Klangwärme und Live-Charakter sind nur drei davon. Unter der Ägide von Dave Cobb ist in Nashville eine bis auf die Rock’n’Roll-Knochen reduzierte Platte entstanden, die mit der Perfektionsstrenge ihrer letzten Alben bricht und dem Soundcharakter und der Aufnahmephilosophie des Produzenten-Tandems George Young/Harry Vanda sowie ihres Lehrlings Mark Opitz bedeutend nähersteht. Das Schlagzeug tönt echt und ganz natürlich und funktioniert auch ohne aufdringliche Snare und überharten Bass-Drum-Kick; die auf althergebrachte Weise mikrofonierten Gitarren wurden knorrig und naturbelassen so im Mix platziert, dass sie sich in Klang und Spielweise ergänzen (›Blood In The Water‹) — mit allen Eigen- und lebendigen Ungenauigkeiten, die in der Hitze des Zusammenspiels auf kleinem Raum entstehen.
Lassen sich Harri Harrison und Joel O’Keeffe mitreißen und schlagen mit ganzer Wucht einen Akkord in die Saiten, passiert es immer wieder, dass sich diese erst auf den korrekten, sauberen Ton einschwingen müssen. Ein solch seelenvolles Donnerwetter wäre bei einer strammgezogenen Marlette-Produktion ebenso undenkbar wie der im Timing leicht verrupfte Upstroke vor der ersten Strophe von ›Switchblade Angel‹, für den O’Keeffe umgehend mit dem Gesicht zur Wand in die Strafecke gestellt worden wäre. Was keinesfalls bedeutet, dass Boneshaker krumm und schief klänge — von Alben wie T.N.T. oder Let There Be Rock würde das schließlich auch kein Mensch behaupten.
Während sich das über alle Maßen swingende ›Switchblade Angel‹ als Energiespritze und Riff-Rock-Erotikum allerreinsten Wassers erweist, pirscht sich weiter vorne ›Burnout The Nitro‹ etwas unauffälliger heran: Zunächst scheint die Nummer Rhino Bucket anzutäuschen, ehe sie Feuer fängt und sich mit bellenden Gang-Chören und einem Ryan O’Keeffe am Schlagzeug, der wie eine muskelbepackte Version von Charlie Watts die Hi-Hat titscht, einer lodernden Klimax entgegenschiebt. Auch im federnden ›This Is Our City‹ hält die Coolness den Sturm in Schach, eine Ode an die alte Bandheimat Melbourne, die mit Mitgrölchören und impulsivem Gesang gefangen nimmt. Wie Joel die einleitenden Worte „dirty“ und „mean“ hervorpresst und mit Bedeutung füllt, ist herzallerliebst; überhaupt wirkt sein Gesang auf Boneshaker ungewöhnlich flüssig und völlig aus dem Bauch heraus — ein ganz anderer Umgang mit Stimme als auf den nicht unerheblich auf Akkuratesse getrimmten Vorgängeralben.
Den Vogel schießen Airbourne mit ›Sex To Go‹ ab: Wie O’Keeffe hier seine Textgeschichte erzählt und unterwegs zwischen Bon Scott-geschultem Storytelling und abmeterndem Rock’n’Roll-Fraggle hin- und herkippt, ist dermaßen entwaffnend charismatisch, dass man sich vor Begeisterung die Oberschenkel wund klopfen möchte. Mehr AC/DC der Jahre 1975 und 1976 geht schwerlich, wobei allerspätestens in dieser Nummer auffällt, wie raffiniert die Band mit den Sounds ihrer Gitarren hantiert. Oder auch in ›Backseat Boogie‹, einer unwiderstehlich fidelen Party-Hymne, in deren Soundbild O’Keeffes Gibson SG (links) mit Harrisons nur wenig verzerrte Schrammel-Les Paul in bester Malcolm-Manier zusammenkommt und ein kraftvolles und doch fluffiges Miteinander erzeugt. Zu hören ist sie lediglich in diesem einen Song, ansonsten bevorzugte der 2017 zugestiegene Gitarrist schweres Halbresonanzgerät.
Gefährlicher als im luftigen ›Weapon Of War‹ wirkten Airbourne nie, bevor sie unter lautem Getöse und imaginär angefeuert von Broken Teeth ihr ureigenes ›Let There Be Rock‹ auf die Abschussrampe rollen: ›Rock’n’Roll For Life‹ bringt nach zehn berauschenden Songs in dreißig Kompaktminuten das Lebensmotto dieses sympathischen Vierers auf den Punkt. Echter wird Rock’n’Roll in diesem Jahr nicht mehr.