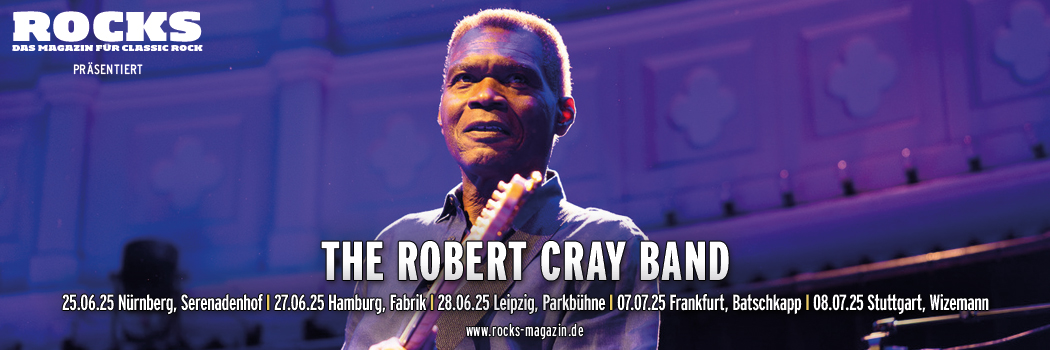Auch mit Starproduzent Andrew Watt (Rolling Stones, Ozzy Osbourne, Eddie Vedder, Miley Cyrus, Iggy Pop) gelingt es der Grunge-Legende nur teilweise, endlich ihr kompositorisches Tief der letzten Jahre zu überwinden. Seit ihrem selbstbetitelten, großartigen achten Album von 2006 fanden sich nur noch vereinzelt gute Songs auf den folgenden drei Werken.
Als Gitarrist Mike McCready im Vorfeld schwärmte, es gebe wieder die Melodie und Energie der ersten beiden Alben, waren die Erwartungen hoch. Zu hoch. Denn Pearl Jam sind offenbar nicht mehr in der Lage, signifikante Riffs und Refrains zu schreiben, sondern setzen stattdessen einzig auf simple Strukturen.
›Running‹ etwa besitzt eine ähnliche Dynamik wie ›Blood‹ von Vs., aber keinen so hohen Erkennungswert — kaum eins der elf neuen Stücke bleibt beim ersten Hören hängen. Da können sie noch so spontan aufnehmen, das Ergebnis ist ein mediokres Alterswerk einer Band, der es seit Jahren nicht mehr gelingt, ihre überragende Live-Performance im Studio zu kanalisieren.
Nur im Balladen- und Midtempo-Bereich vermögen sie zu begeistern, wie ›Wreckage‹, ›Won’t Tell‹, ›Something Special‹ und ›Got To Give‹ beweisen. Aber lange Gitarrensoli wie in ›Waiting For Stevie‹ haben nichts mit Härtegraden zu tun.