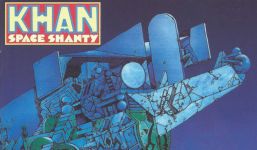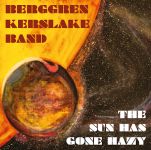Bruce, liest du selbst gern Autobiografien anderer Rockmusiker? Genug davon gibt es heutzutage ja.
»Nein, so was lese ich eigentlich nie. Die meisten scheinen mir einfach nicht sonderlich interessant zu sein. Meist geht es den Autoren darum, schreckliche Dinge über ihre Exfrauen und andere Leute zu äußern, die sie in ihrem Leben getroffen haben. Oder sie suhlen sich in Selbstmitleid. Da widme ich mich lieber gehaltvolleren Büchern.«
Dein eigenes verdient zweifelsohne das Prädikat „gehaltvoll“. Wie schwer war es, dir all die beschriebenen, sehr unterschiedlichen Vorkommnisse in Erinnerung zu rufen?
»Ach, das war nicht sonderlich schwierig. Ich habe ein ziemlich schreckliches Namensgedächtnis, aber an Situationen kann ich mich normalerweise sehr gut erinnern.«
Hast du jemals ein Tagebuch geführt?
»Nie, zu keinem Zeitpunkt!«
Du bist in bescheidenen Verhältnissen in einer Sozialbausiedlung in Worksop aufgewachsen. Haben diese frühen Kindheitsjahre dich später angespornt, etwas aus deinem Leben zu machen?
»Nein. Mein Großvater, der mich hauptsächlich großgezogen hat, war beispielsweise glücklich damit, Grubenarbeiter zu sein. Mein Vater hatte allerdings eine sehr ausgeprägte Arbeitsmoral. Er zog ein Geschäft nach dem anderen auf, führte mit meiner Mutter ein Hotel oder verkaufte Autos. Das hat wahrscheinlich schon etwas auf mich abgefärbt.«
Auch ein Talent für sportliche Betätigungen scheint bei euch in der Familie zu liegen. Dein Vater war in jungen Jahren ein talentierter Schwimmer, deine jüngere Schwester Helena wurde eine erfolgreiche Springreiterin. Du selbst warst in den Achtzigern ein leidenschaftlicher Fechter und hast Großbritannien bei internationalen Wettkämpfen vertreten.
»Meine Mutter war zudem eine sehr gute Tänzerin. Sie gewann ein Stipendium für die Royal Ballet School, aber ihre Mutter erlaubte ihr nicht, nach London zu ziehen. Nicht zu vergessen meine Urgroßmutter, die Sprinterin war. An dem Familientalent ist also offenbar schon was dran. Meine Schwester, die mit Anfang zwanzig nach Deutschland gezogen ist, bestreitet zwar schon länger keine Wettkämpfe mehr, aber ihr Sohn Thomas ist in ihre Fußstapfen getreten.«
Fechtest du denn heute noch?
»Klar! Ich habe vor ein paar Wochen sogar wieder angefangen zu trainieren. Es macht mir immer noch großen Spaß. Wie sonst kannst du mit jemandem einen Säbel-Kampf austragen, ohne direkt verhaftet zu werden? (lacht) Fechten ist eine wunderbare Kombination aus Körperkoordination und Gehirnarbeit. Deine grauen Zellen werden angeregt, einfallsreiche Lösungen zu finden. Es hat viel mit Leidenschaft und auch mit einem gewissen Maß an Aggressivität zu tun. Fechten bringt all das auf eine sehr fokussierte und harmonische Weise zusammen. Anfangs habe ich mich doppelt so sehr beweisen müssen wie ein normaler Fechter. Wenn du als bekannter Musiker in einem Fechtclub mitten im Nirgendwo aufkreuzt, wirst du erst mal schief angeschaut. In meinem Job als Pilot war das später nicht anders.«
Deine Liebe zum Fechten wurde durch einen früheren Lehrer von dir geweckt. Ansonsten scheint deine Schulzeit aber ziemlich furchtbar gewesen zu sein. Du wurdest gemobbt und von älteren Schülern und sogar Lehrern verprügelt.
»Dabei habe ich im Buch sogar ein paar Dinge unter den Tisch fallen lassen, die ein noch schlimmeres Bild hätten entstehen lassen. Positiv war, dass es eine Privatschule mit unglaublich tollen Einrichtungen war. Sie war verdammt teuer, und meine Eltern mussten viele Opfer bringen, um die Gebühren bezahlen zu können. Ich kam dort mit vielen Sachen in Berührung, zu denen ich auf einer öffentlichen Schule keinen Zugang gehabt hätte. Allerdings machte das den Schulalltag insgesamt nicht wirklich besser.«
Dein Interesse an Rockmusik hat die Band Wild Turkey entfacht, die heute nicht mehr vielen ein Begriff sein dürfte. Was mochtest du an ihr?
»Das war schlicht und einfach die erste Gruppe, die ich live gesehen habe. Die hatten aber auch ein sehr gutes erstes Album namens Battle Hymn, das ich bis heute als Klassiker schätze. Ihr Sänger Gary Pickford-Hopkins, der später für Rick Wakeman gesungen hat, war ebenfalls klasse. Ich habe ja die Vermutung, dass ein paar der Texte auf dieser Scheibe später einige Songs von Saxon stark beeinflusst haben. (lacht) Aber vielleicht ist das auch nur Zufall.«
Ursprünglich wolltest du nicht Sänger, sondern Schlagzeuger werden. Wieso?
»Ein Schlagzeug macht Lärm, du fuchtelst mit den Armen herum und schwitzt stark. Sowas findet man als Jugendlicher super. Es ist einfach aufregend!«
Schließlich hast du dich aber fürs Singen entschieden.
»Und zwar deshalb, weil ich gut darin war! Mit dem Schlagzeugspielen hätte es ohnehin nicht geklappt. Erstens konnte ich mir kein Drumkit leisten, zweitens hätte ich es nicht vor meinen Eltern verstecken können und drittens konnte ich nicht Auto fahren. Ich hätte also das Schlagzeug nicht von einem Ort zum anderen transportieren können. Das ging mir alles mächtig auf die Nerven. Glücklicherweise merkte ich sehr bald, dass ich eine gute Stimme habe.«
Bei einer Gesangsprüfung in der Schule bist du allerdings durchgerasselt.
»Damals bin ich absichtlich durchgefallen. Ich hatte einfach keine Lust, in den Schulchor aufgenommen zu werden. Das wären vergeudete Sonntage gewesen.«
Vor Iron Maiden hattest du dir einen Namen bei Samson gemacht. Auf Tour mit ihnen hast du erstmals dein Idol Ian Gillan getroffen, von dessen stimmlicher Verfassung du aber eher ernüchtert warst. Als du ihm über den Weg gelaufen bist, hatte er eine Zigarette in einer Hand und eine Flasche Whisky in der anderen.
»Genau das ist Ian! (lacht) Und so war er den Großteil seines Lebens.«
Hast du daraus Schlussfolgerungen gezogen, wie du deine eigene Stimme behandeln solltest?
»Gewisse Sachen habe ich bewusst gemieden. Im Gegensatz zu meinem Vater, der sein ganzes Leben geraucht hat und vor wenigen Wochen an Lungenkrebs gestorben ist, habe ich mich von Zigaretten immer ferngehalten. Und statt Whisky trinke ich lieber Bier. Manche meiner Lieblingssänger haben sich gut gehalten. Ronnie James Dio war so ein Fall. Paul Rodgers klingt immer noch fantastisch. Ian sang anfangs phänomenal, aber dann passierte irgendwas Seltsames mit seiner Stimme. Bei Robert Plant genauso, obwohl ich seine Solosachen liebe. Aber sein Gesang klingt heute völlig anders, das hat nicht mehr viel mit dieser gewaltigen Stimme auf Led Zeppelin II zu tun. Womöglich ist das Ganze auch eine Frage der genetischen Veranlagung.«
Du schreibst, dass du deine allseits bekannte und gefeierte Gesangsstimme dank Tony Platt, dem Produzenten der Samson-LP Shock Tactics, gefunden hast. Allerdings hast du sie zunächst gehasst.
»Das ist doch auch verständlich, oder? Es ist vergleichbar mit einem Schauspieler, der sich bei Dreharbeiten zum ersten Mal vor der Kamera agieren sieht. Ich kenne einige Schauspieler, und viele hassen es, sich selbst auf der Leinwand zu sehen. Sie denken, dass sie schrecklich rüberkommen, und fühlen sich in solchen Momenten nackt und verletzlich. Ich konnte mit meiner Stimme andere Sänger kopieren. Ich glaube, ich wäre ein guter Mann für eine Deep Purple-Coverband gewesen. (lacht) Aber auf diese Weise geht man natürlich kein Risiko ein. Du musst deine Komfortzone verlassen und dich an einen anderen Ort begeben. Als ich das dann tat, habe ich mich zunächst sehr unwohl gefühlt. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass irgendjemand das gut findet! Aber es war notwendig, um zu meiner eigenen Identität zu gelangen.«
Mit Iron Maiden hast du danach einen steilen Aufstieg erlebt. Anteil daran hatte auch euer damaliger Stammproduzent Martin Birch, den du mit einigen sehr unterhaltsamen Anekdoten verewigt hast. Er verwandelte sich laut deinem Buch hin und wieder in ein Alter Ego namens Marvin, das völlig betrunken außer Rand und Band geriet.
»Schon vor Jahren hat Martin mal einem Iron Maiden-Fanclub-Magazin ein sehr langes Interview gegeben, in dem er sehr genau auf die verrückten Dinge eingegangen ist, die er früher so getrieben hat. (lacht) Das war längst nicht nur bei den Produktionen unserer Platten der Fall, sondern auch bei der Arbeit mit anderen Bands. Martin kann ein schwer unterhaltsamer Typ sein, dabei ist er eigentlich ein sehr seriöser Mensch. Marvin brach nur sehr selten aus ihm heraus. Er hat sich vor langer Zeit aus dem Musikgeschäft zurückgezogen, und ich nehme an, dass Marvin sich mit ihm zur Ruhe gesetzt hat (lacht).«
Seine letzte Produktion war Fear Of The Dark. Damals war er grade mal Mitte vierzig.
»Ich kann natürlich nicht für Martin sprechen, aber ich habe eins an ihm beobachtet: Er hat in jede einzelne Platte eine Menge von sich selbst gesteckt. Es war, als hätte er jedes Mal einen Teil seiner Seele geopfert. Das fordert irgendwann seinen Tribut, du kannst so nicht ewig arbeiten. Es war ein herber Verlust für die Musikbranche, er war ein Ausnahmetalent. Aber genau das hatte eben auch seinen Preis. Manchmal haben ihn Plattenaufnahmen fast verrückt gemacht. Doch soweit ich weiß, geht es ihm gut. Er soll glücklich sein, viel Golf spielen und angeln. Wenn dem so ist, freut mich das.«
Ansonsten hältst du dich mit Schilderungen von Partyeskapaden merklich zurück — ein Unterschied zu den meisten anderen Rockstar-Autobiografien.
»Ich bin nun mal kein gewöhnlicher Rockstar! Nur wenige Musiker machen nebenher so viele ganz unterschiedliche Sachen wie ich. Wer Ausschweifungen will, sollte sich die Hangover-Filme ansehen oder Fear And Loathing In Las Vegas lesen. Mehr geht in der Hinsicht nicht. Und wem das nicht humorvoll genug ist: Auch der Mittelteil von This Is Spinal Tap ist sehr empfehlenswert.«
Zeitgleich mit dem Erscheinen von What Does This Button Do? wurden deine sechs Soloalben als Vinyl-Boxset wiederveröffentlicht. Die umstrittenste dieser Scheiben dürfte Skunkworks von 1996 sein.
»Ich finde, es ist eine tolle Platte mit sehr coolen Songs. Sie mag eine etwas depressive Stimmung haben, was nicht unbedingt meiner normalen Gemütslage entspricht. Aber sie entstand in einer recht düsteren Zeit in meinem Leben. Das Gitarrenspiel darauf ist großartig. Al Dickson war einer der besten Gitarristen, mit denen ich je gearbeitet habe.«
Im Vergleich zum sehr heterogenen Vorgänger Balls To Picasso fühlte sich die Scheibe wesentlich stringenter an. Du scheinst für Skunkworks eine klarere Vision verfolgt zu haben.
»Das sehe ich auch so. Balls To Picasso wurde quasi aus drei Aufnahmesessions zusammengenäht. Sie entstand wie Frankensteins Monster! Ich wünschte, ich hätte damals schon den Mut besessen, das Album von Roy Z produzieren zu lassen, dann wäre es ganz anders und wahrscheinlich viel härter geworden. Aber wir kannten uns erst kurze Zeit. Der große Moment auf Balls To Picasso ist ›Tears Of The Dragon‹. Dieser Song hat die Scheibe gerettet, wenn man so will, obgleich ein paar der anderen Lieder auch gut sind. ›Laughing In The Hiding Bush‹ fällt mir spontan ein.«
›If Eternity Should Fail‹, der Eröffnungssong des letzten Iron Maiden-Werks The Book Of Souls, war eigentlich für ein weiteres Soloalbum von dir gedacht. Gedenkst du dieses Projekt noch anzugehen?
»Das würde ich gern. Natürlich haben Iron Maiden Priorität, und die Band nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Ich glaube, ich habe fünf Songs in Demo-Form aufgenommen, also stehen ungefähr vierzig Prozent der Platte. Ich müsste somit noch zusätzliche Songs schreiben. Unter Umständen könnte eine Art Konzeptalbum daraus werden. Mal schauen. Es liegt noch jede Menge Arbeit vor mir. Aber ich hoffe sehr, dass ich die Platte irgendwann fertigstellen kann.«