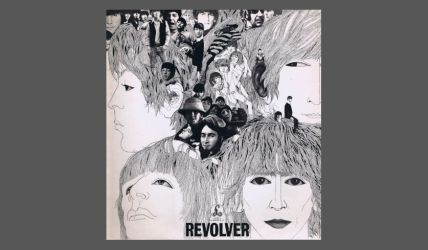Die alten Opeth sind zurück, mag man unwillkürlich denken, wenn nach einer guten Minute zu pumpenden Riffs der erste herzhafte Growl von Mikael Åkerfeldt ertönt. Weg waren sie natürlich nie, auch wenn sich diese spannende schwedische Band nach Blackwater Park (2001) immer genussvoller und konsequenter ihrer ganz eigenen und immer eigensinnigen Interpretation des Progressive Rock der Siebziger hingab.
Ein bloßer Rückschritt in harte Metal-Gefilde ist The Last Will And Testament deshalb aber nicht. Zwar vereint das Album viele Aspekte des bisherigen Opeth-Schaffens, es denkt diese aber auch in einem dichten Konzept um das dunkle Vermächtnis eines reichen Familienvaters konsequent weiter. So verschmelzen in den dick und modern produzierten „7 Paragrafen“ des Testaments und der abschließenden Ballade ›A Story Never Told‹ Riffs und Growls, irres Spiel mit Dynamik, schaurig-schöne Melodien, Spoken-Word-Einlagen, Einflüsse aus unterschiedlichen Folk-Traditionen, balladeskes Piano und technische Finesse zu einem harmonischen Ganzen.
Dabei verweilt Åkerfeldt nie zu lange bei einer Idee, wodurch Opeths Musik eine neue Dimension erhält: Kurzweiligkeit. Auch weil sich der Frontmann zwischen Gutturalem und Falsett (und allem dazwischen) so vielseitig zeigt, wie nie. Vor allem aber liefert das Album denkwürdige Momente am laufenden Band.
Die sich stetig nach oben schraubenden Verse von ›§3‹, der cineastische Flöteneinsatz in ›§4‹ von Gast Ian Anderson (Jethro Tull), der in der Rolle des Patriarchen auch eine beeindruckende Spoken-Word-Performance beisteuert, oder die exotisch-vertrackte Bridge von ›§5‹ sind nur die Spitzen eines Eisbergs, dessen Dimensionen sich mit jedem Durchlauf mehr erschließen.